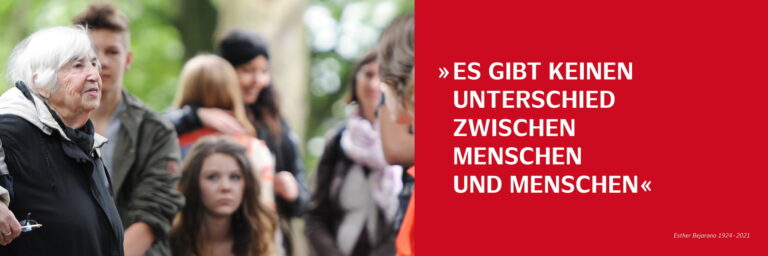Diskussion/Gespräch | Film
Widerstand // Filmraum und Gespräch
Gedenkstätte Bullenhuser Damm , Bullenhuser Damm 92-94, 20539 Hamburg
kostenlos
Programm:
17:00 Uhr: "Dann vergesse ich alles” von Daniel Poštrak u.a. / 15 min // PREMIERE mit Gästen
17:45 Uhr: “Mirjam - Leben mit Mauthausen” von Allegra Schneider u.a. / 37 min
19:00 Uhr: “Wir dürfen es nicht vergessen” von Thorsten Wagner / 74 min
21:00 Uhr: “Nelly & Nadine “ von Magnus Gertten / 92 min
Dann vergesse ich alles
Aufgereiht treiben die Fahrzeugkarosserien langsam durch eine Industriehalle. Von Hand schleift Ali Rıza Ceylan hier Lackierfehler. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet er bei Ford am Fließband. In den Pausen zieht er sich zurück. An einem Tisch, abseits des Produktionstrubels, sitzt Ali Rıza und lässt im Schein einer Neonröhre auf den Resten der Schleifpapiere Kunstwerke entstehen. „Malen tut mir gut“ sagt er. Selbst seine Erfahrung als Überlebender von rassistischem Terror tritt dann in den Hintergrund. Ali Rızas Bilder entstehen nicht für das große Publikum und finden überraschend doch ihren Platz in einem großen Museum. „Dann vergesse ich alles“ ist ein Film über den durch rassistische Gewalt verursachten Schmerz, die Widerstandskraft durch Kunst und nicht zuletzt, die Geschichte einer späten Anerkennung.

Mirjam - Leben mit Mauthausen
Mirjam Ohringer wurde 1924 geboren. Schon als Kind unterstützte sie mit ihren Eltern Untergetauchte, die aus Deutschland in die Niederlande flohen. Als die Niederlande von den Deutschen besetzt werden ist sie 16 Jahre alt und im kommunistischen Milieu aktiv, z.B. bei der Verbreitung der kommunistischen Parteizeitung „Wahrheit“. Im Jahr 1942 musste sie untertauchen, weshalb sie den Krieg überlebte.
1982 fuhr sie zum ersten Mal nach Mauthausen, wo ihr Verlobter Ernst Josef Prager ermordet worden war. Sie wurde zum Gründungsmitglied des Niederländischen Mauthausen-Komitees, dessen Vorsitzende sie zuletzt auch war. Am Ende ihres Lebens erzählt sie vom antifaschistischen Widerstand und den Verlusten, die bis heute wirken.
Trailer: hier


Wir dürfen es nicht vergessen
Der Dokumentarfilm porträtiert die Hamburgerin Antje Kosemund, die 1928 geboren wurde und in einer Arbeiterfamilie aufgewachsen ist.
Ihr Vater wurde im Mai 1933 durch die Gestapo verhaftet, ihre Mutter starb früh und ihre Schwester Irma fiel dem »Euthanasie«-Mordprogramm der Nazis zum Opfer. Im Gespräch mit ihr erscheinen Menschen, Orte, Straßen und Gebäude. Sie alle erzählen ihre Geschichte vom kommunistischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus und von einer Spur im Vernichtungsprogramm der Aktion T4, die bis nach Wien führt. Antje Kosemunds Erinnerungen sind Zeugnis eines widerständigen Lebens und ein Dokument gegen das Vergessen.
Trailer: hier


Nelly & Nadine
Der Film erzählt die unglaubliche Geschichte zweier Frauen, die sich in einem Konzentrationslager ineinander verlieben. Die belgische Opernsängerin Nelly Mousset-Vos und die chinesische Widerstandskämpferin Nadine Hwang lernen sich Heiligabend 1944 im KZ Ravensbrück kennen, wo beide Gefangene sind. Kurz vor Kriegsende werden sie getrennt, finden sich wieder, ziehen nach Venezuela, um dort ihre Liebe frei leben zu können. Viele Jahre lang wurde Nellys und Nadines bemerkenswerte Liebesgeschichte geheim gehalten, sogar vor engsten Familienmitgliedern. Jetzt hat Nellys Enkelin Sylvie das Privatarchiv des Liebespaars geöffnet. Magnus Gertten berührender Dokumentarfilm erzählt anhand von Nellys Tagebuch und Fotos, Liebesbriefen und Filmrollen eine bemerkenswerte Geschichte über den Horror des Krieges, gut gehütete Familiengeheimnisse und die Liebe gegen alle Widerstände. Der Film wurde bei der BERLINALE mit dem Teddy Award ausgezeichnet, die höchste Ehrung für einen LGBTQ+ Film.
Trailer: hier


Salon und Filmraum:
Das Gebäude in Rothenburgsort, das 1944/45 als Außenlager des KZ-Neuengamme diente, ist heute in Teilen eine Gedenkstätte, die v.a. an die dort kurz vor Kriegsende von der SS ermordeten 20 jüdischen Kinder und 28 Erwachsenen erinnert. Abgesehen von einer Kita sind weite Flächen des Hauses jedoch seit Jahrzehnten ungenutzt. Für vier Tage aktivieren wir diesen Leerstand als einen Raum zum Reden, Zuhören und Filme schauen – samt einer Ausstellung zum Spannungsfeld „Gedenkorte und Stadtentwicklung“.
Der aktuelle Rechtsruck mit seinen west- und ostdeutschen Ausprägungen verschiebt die gesellschaftlichen Aufmerksamkeitsökonomien in einer Weise, dass ohnehin marginalisierte Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Und das alles geschieht innerhalb des Kontextes neoliberaler Stadtentwicklung, in denen Räume des Austauschs eher weniger als mehr werden und Gedenkorte in erster Linie über Besucher*innenzahlen bewertet und als Tourismusziele geratet werden. Gedenkorte sind erkämpfte Räume. Erkämpft von betroffenen Communities, Initiativen, Angehörigenverbänden und Allys für die “Gesellschaft”, die Allgemeinheit, in langwierigen Prozessen. Die Frage nach der Notwendigkeit und der Ausgestaltung von Erinnerungsorten muss stets am konkreten Ort aktualisiert werden. Die Debatte über eine künftige, darüber hinausgehende Nutzungsform, die Zugänglichkeit und historische Bedeutung des Ortes mit einbezieht, gilt es im Kontakt miteinander zu führen.
Lasst uns gemeinsam darüber nachdenken, wie gemeinwohlorientierte, soziokulturelle und stadtteilbezogene Zukünfte im Spiegel der Vergangenheit projiziert werden können.
Mehr Informationen hier
Veranstalter

Fr 25.04.25
17:00 Uhr
Gedenkstätte Bullenhuser Damm
Bullenhuser Damm 92-94
20539 Hamburg
kostenlos